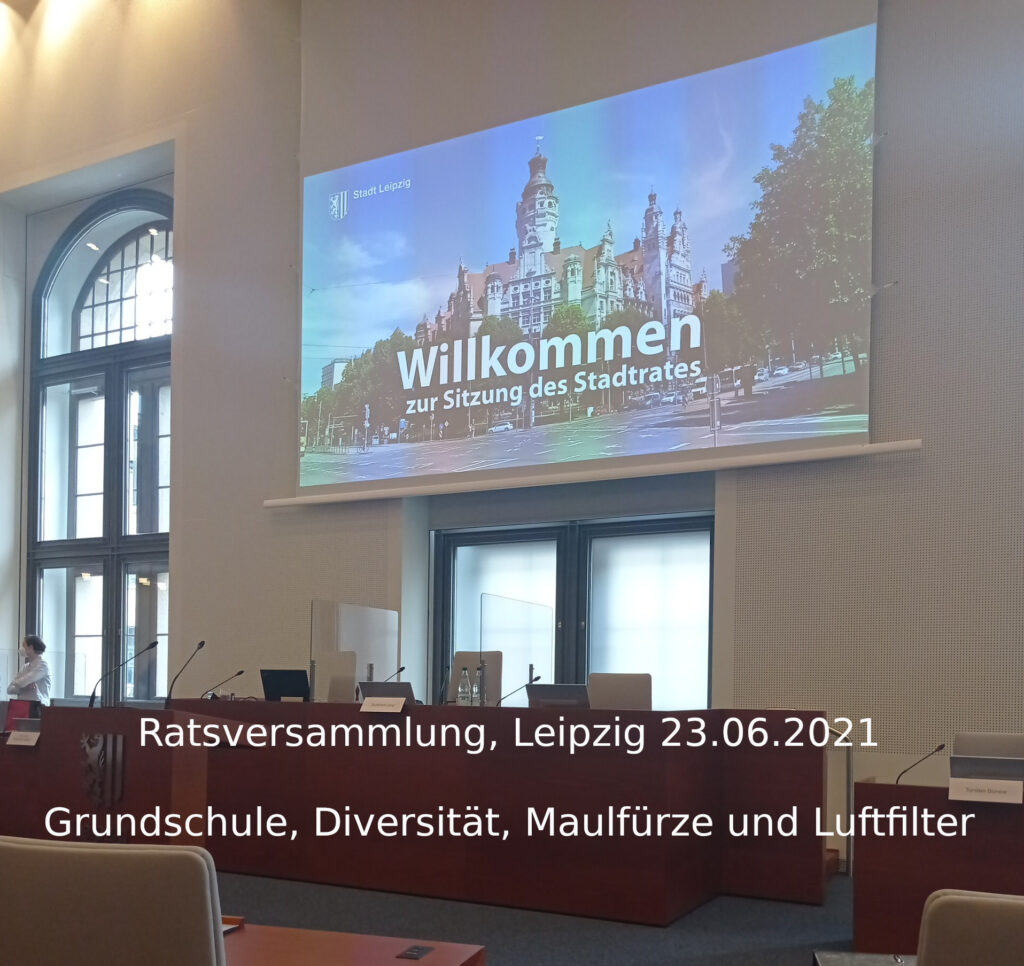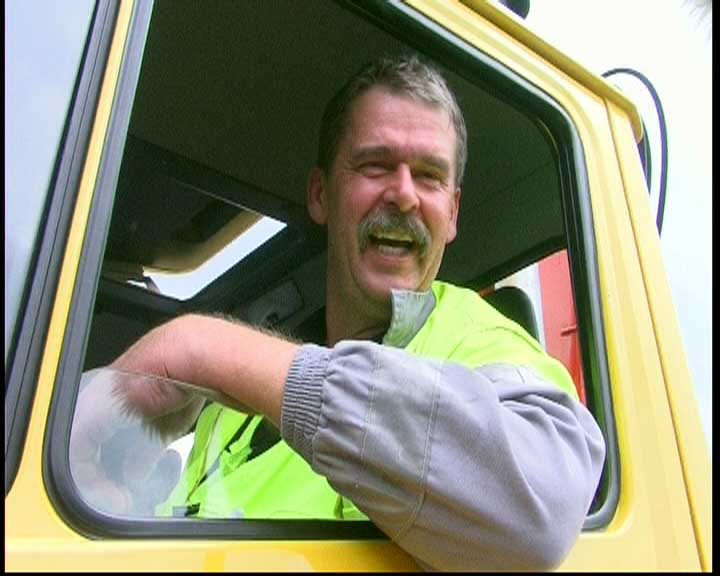Thomas Köhler
Stadtrat der Piratenpartei
Fraktion Freibeuter im Leipziger Stadtrat
Neues Rathaus
Zimmer 101
Martin-Luther-Ring 4-6
04109 Leipzig
Allgemeiner Deutscher Automobil-Club Sachsen e.V.
Helmut Büschke
Vorstandsmitglied für Verkehr und Technik
Striesener Straße 37
01307 Dresden
Leipzig, 28.05.2021
Verkehrspolitik des Stadtrates in Leipzig
Sehr geehrter Herr Büschke,
vielen Dank für Ihr Schreiben, auf das ich Ihnen gern antworte.
Zur Einleitung eine kurze Vorstellung. Ich bin 64 Jahre alt, gelernter Kfz-Schlosser und Ingenieur für Maschinenbau/Kraftfahrzeugtechnik. Von 1994 bis 2008 war ich als Mitarbeiter im Pannenhilfs-, Abschlepp- und Bergungsdienst erst für den AvD und dann 10 Jahre für den ADAC in Leipzig und Bremen tätig. Meine letzte Tätigkeit war Betriebsleiter eines Straßendienstpartners.
Diese Erklärung war vielleicht notwendig, um mir keine generelle Autofeindlichkeit unterstellen zu können.
Ziel meines Engagements in der Verkehrspolitik der Stadt Leipzig ist eine gleichberechtigte Teilnahme aller Verkehrsarten am Straßenverkehr und besonders eine Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Aus diesem Ziel heraus leite ich die Förderung des Radverkehrs, des Fußverkehrs und insbesondere des ÖPNV ab. Daraus resultiert mein Bestreben nach einer Änderung der bisherigen Verkehrspolitik, die eine Dominanz des motorisierten Individualverkehrs zementierte.
Eine Zahl nur, der Gesamtflächenverbrauch aller in Deutschland zugelassenen PKW (ohne Anhänger), lt. Statista 48,249 Mio im Jahr 2021, beträgt ohne die Einrechnung von Parkabständen rund 506,6 km². Das entspricht ungefähr 67% der Gesamtfläche der Freien und Hansestadt Hamburg. Es ist also ein sehr großer Parkplatz. Nehmen wir noch die PKW-Anhänger, LKW mit Anhängern oder Aufliegern und die Sonderfahrzeuge hinzu, dann bewegt sich wahrscheinlich täglich ein Saarland durch Deutschland – oder es steht dort herum.
Da sich der Verkehrsraum nicht, oder nur gering, baulich erweitern lässt, kann dieser eben nur neu aufgeteilt werden. Dies muss zu Gunsten der bisher benachteiligten Verkehrsarten geschehen.
Ein besseres Miteinander aller VerkehrsteilnehmerInnen muss auf Augenhöhe der einzelnen Verkehrsarten zustande kommen und ist hoffentlich unser gemeinsames Ziel.
Kommen wir zu den von Ihnen benannten Schwerpunktthemen:
Generelles Tempo 30
Ich möchte wirklich nicht belehrend klingen, aber es gibt keine Bestrebungen eine generelle Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h einzuführen. Vielmehr geht es um einen Modellversuch mit einer Regelgeschwindigkeit.
Wer den Beschluss des Stadtrates liest und versteht weiß auch, dass eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h keine generelle Höchstgeschwindigkeit darstellt.
Es gilt momentan eine Regel-Höchstgeschwindigkeit in Ortschaften von 50 km/h was bedeutet, es kann Ausnahmen geben. So die von Ihnen benannten Tempo-30-Zonen, aber auch Straßen oder Abschnitte mit Tempo 60 oder 70.
Was ändert sich also? Ich zitiere mich hier selbst, obwohl das schlechter Stil ist.
„Tempo 30“ als Regelgeschwindigkeit ist ein Paradigmenwechsel in der Bewertung des Verkehrsraumes. Es wird nicht mehr gefragt „Unter welchen Bedingungen können wir eine Straße oder ein Gebiet auf Tempo 30 herabsetzen?“. Die Frage ist:
„Wie muss eine Straße beschaffen sein, damit dort mit „Tempo 50“, oder auch schneller gefahren werden kann?“
Aus meiner Sicht sind also die von Ihnen gezogenen Schlussfolgerungen aus dem Beschluss des Stadtrates nicht zutreffend.
Einige Ausführungen dazu:
Die Aussage im Absatz 1 „Über 70% der Leipziger Straßen sind mit einer Tempo-30-Regelung versehen…“ ist irreführend, sie impliziert, dass auf über 70% der Straßen Tempo 30 gilt. Richtiger wäre es wohl zu sagen, dass es auf über 70% der Straßen, zumindest auf Abschnitten, Tempo-30-Regelungen gibt.
Weiter schreiben Sie: „Hauptverkehrsstraßen sind bautechnisch für ein Tempo von 50 km/h angelegt und Unfälle passieren dort meist an Kreuzungen oder Einmündungen, wo allein systembedingt geringere Geschwindigkeiten gefahren werden.“
Auch hier muss man die Betrachtung korrigieren. Die meisten Hauptverkehrsstraßen in Leipzig, mit wenigen Ausnahmen wie der Gerberstraße zwischen Wilhelm-Liebknecht-Platz und Innenstadtring, sind, wie die Georg-Schumann-Straße, ursprünglich für den Straßenbahnverkehr und geringe Kfz-Nutzung gebaut worden. Der Ausbau zur „einigermaßen-autogerechten-Straße“ erfolgte ab den späten 1960er Jahren und war von vornherein nicht ausreichend.
Besonders durch die kurz aufeinanderfolgenden rechtwinkligen Einmündungen, mit kurzen Krümmungen, und die relativ kurzen Abstände der Haltestellen von Bahn und Bus, ist in diesen Straßen eine Geschwindigkeit von 50 km/h eine eher theoretische Möglichkeit. Das gilt für Kfz und ÖPNV.
Die an den Kreuzungen und Einmündungen erhöhte Unfallhäufigkeit resultiert besonders aus fehlendem Mindestabstand der Fahrzeuge bei Bremsvorgängen. Ein Grund ist auch die Sichtbehinderung, durch im Kreuzungsbereich parkende Fahrzeuge, für die in den Kreuzungsbereich einfahrenden Kfz.
Kurz noch zum Abend-, Nacht- und Wochenendverkehr und zur Erhöhung der Reisezeiten. Sie haben das schon richtig formuliert, das gilt tatsächlich nur zu diesen Zeiten. Gerade im Berufsverkehr ist meist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von weit unter 50 km/h möglich. Verlängern sich die Reisezeiten nun wirklich? Wenn der Verkehr mit 30 km/h flüssig läuft, dann scheint der Unterschied in der Fahrzeit innerhalb von Leipzig erheblich zu sein. Immerhin benötigt man für 10 km Strecke mit 50 km/h nur 12 Minuten, gegen über 20 Minuten mit 30 km/h.
Hier muss ich auf meine Einleitung „Was bedeutet Regelgeschwindigkeit“ hinweisen. Wenn Straßen die nach den Kriterien für 50, 60 oder 70 km/h geeignet sind aus der 30er Regelgeschwindigkeit herausgenommen werden, dann sieht das anders aus. Wenn überhaupt, dann werden Autofahrende auf die Straßen mit höherer Regelgeschwindigkeit ausweichen.
Mein Fazit hierzu ist:
Der Modellversuch ist richtig und die Ergebnisse werden für sich sprechen, ob nun für oder gegen die generelle Einführung. Wenn der Modellversuch positive Ergebnisse bringt, dann sind diese auch für die Kfz-Nutzer positiv und die Akzeptanz steigt.
Radfahren auf dem Ring
Natürlich kann man sich über die Notwendigkeit der Nutzung des Innenstadtrings durch den Radverkehr streiten. Übrigens, sie verwenden für diesen den Ausdruck „Promenadenring“, den ich bevorzuge. Der Ring als Promenade – das wäre schön. Aber Spaß beiseite.
Meine Antwort ist hier: „Ja, die Nutzung des Promenadenringes durch den Radverkehr ist notwendig.“
Das hat mehrere Gründe.
- Die Leipziger Innenstadt soll nicht für den Durchgangsverkehr durch die ständig steigende Anzahl von Radfahrenden genutzt werden. Eine wirklich erlebenswerte Innenstadt lebt vom Fußverkehr.
- Bis auf wenige Ausnahmen sind die Alternativstrecken für Radfahrende, außerhalb des Promenadenringes, relativ enge Straßen, die auch vom Kfz-Verkehr genutzt werden und meist zugeparkt sind. Hier besteht, auch durch Dooring, eine hohe Unfallgefahr.
- Radfahren ist heute kein Hobby oder Sport, es ist eine gleichwertige Verkehrsart und muss auch so behandelt werden.
In einem gebe ich Ihnen natürlich Recht. Fahrbahnmarkierungen stellen keinen Schutz für Radfahrende dar. Die Alternative wäre dann natürlich der Rückbau einer Fahrbahn und Ausbau von separaten Radwegen mit Bord.
Ich bin jederzeit für einen weiteren Gedankenaustausch, auch in Gesprächsrunden oder Foren, bereit.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Köhler